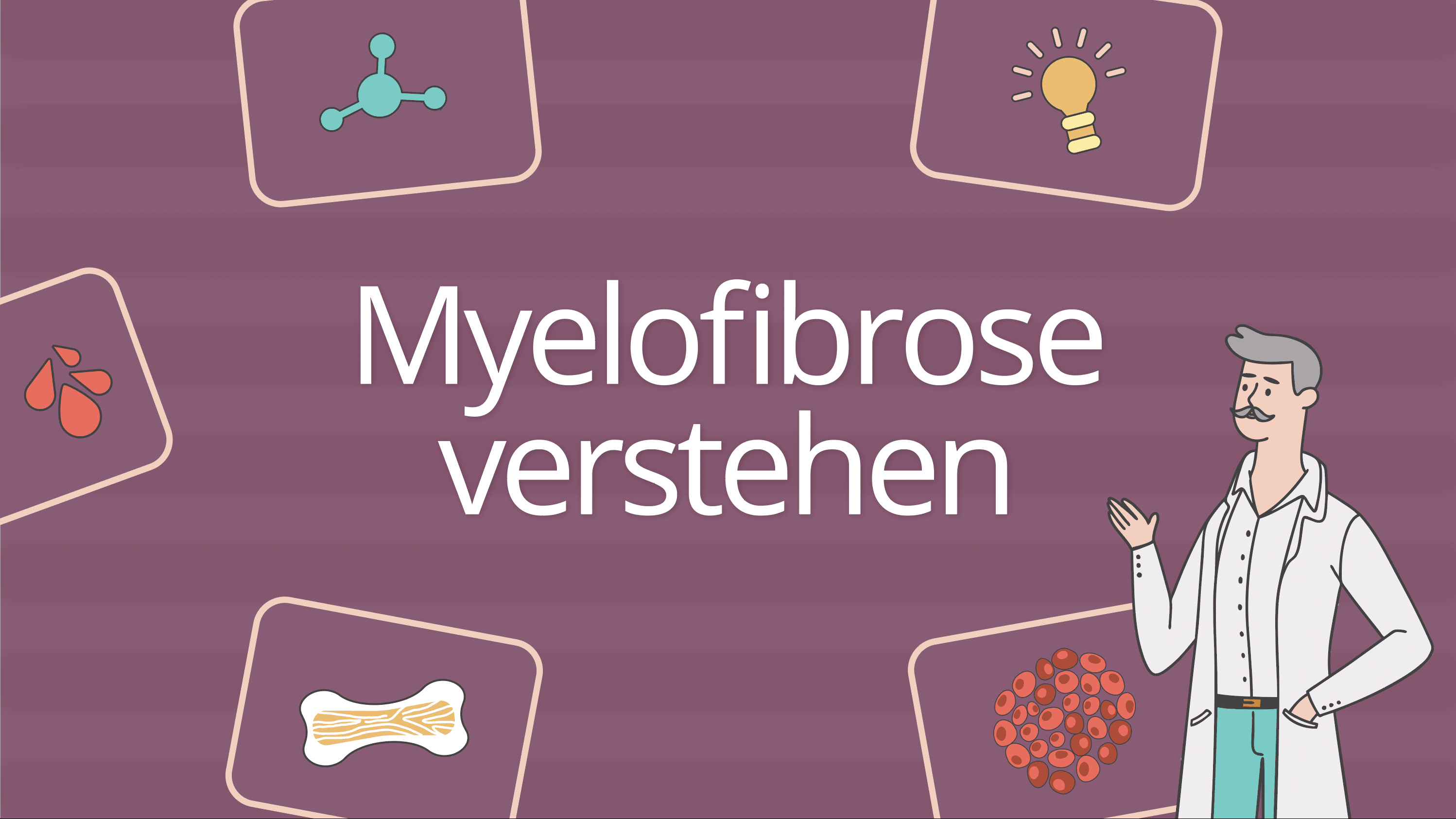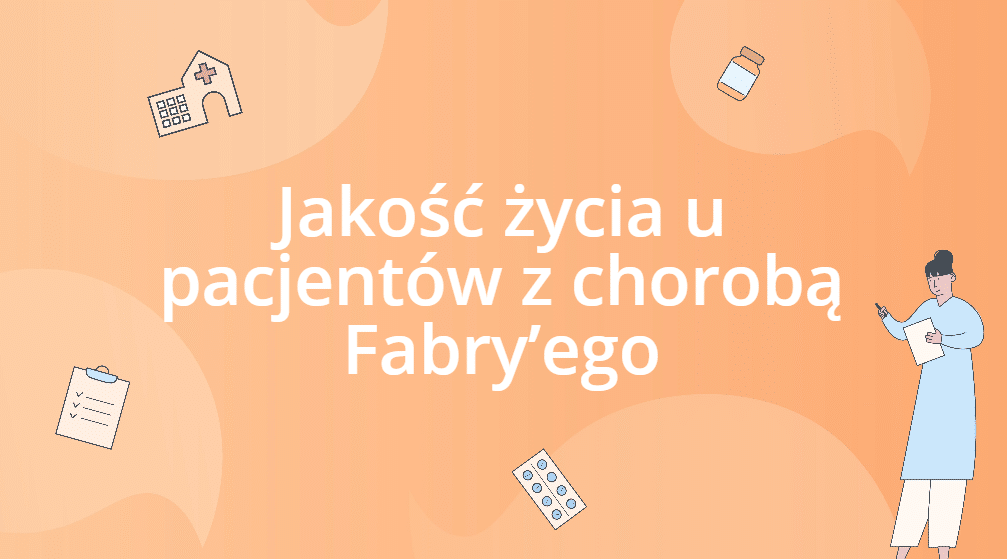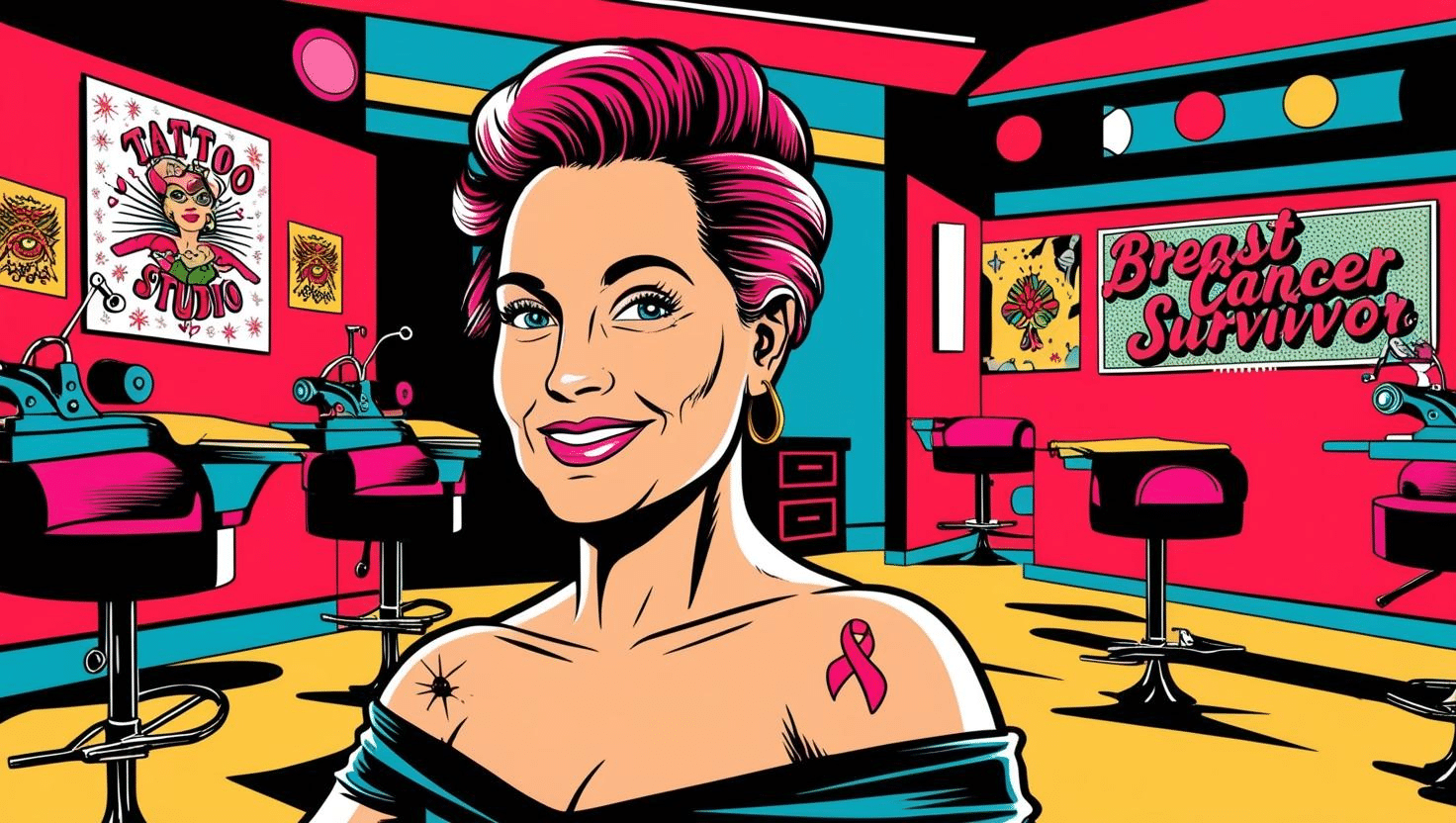Krebsdiagnose verarbeiten: Die ersten Schritte
selpers: Wenn die Diagnose Krebs lautet – wie reagieren die Menschen darauf meistens?
Ochsner: Im ersten Moment ist es für alle ein Schock, eine existenzielle Bedrohung. Selbst für jene Patienten, die bereits vermutet haben, dass die Erkrankung ernst ist, ist die Diagnose schockierend. Es gibt Tränen, manche schreien, andere erstarren oder sagen: ‚Das kann nicht sein’. Rational versteht zwar jeder, was Sache ist, aber Verdrängen hilft und ist notwendig. Die Frage ist, wie lange verdränge oder verleugne ich. Ich unterstütze die Patienten, es in ihrem Tempo aufzulösen.