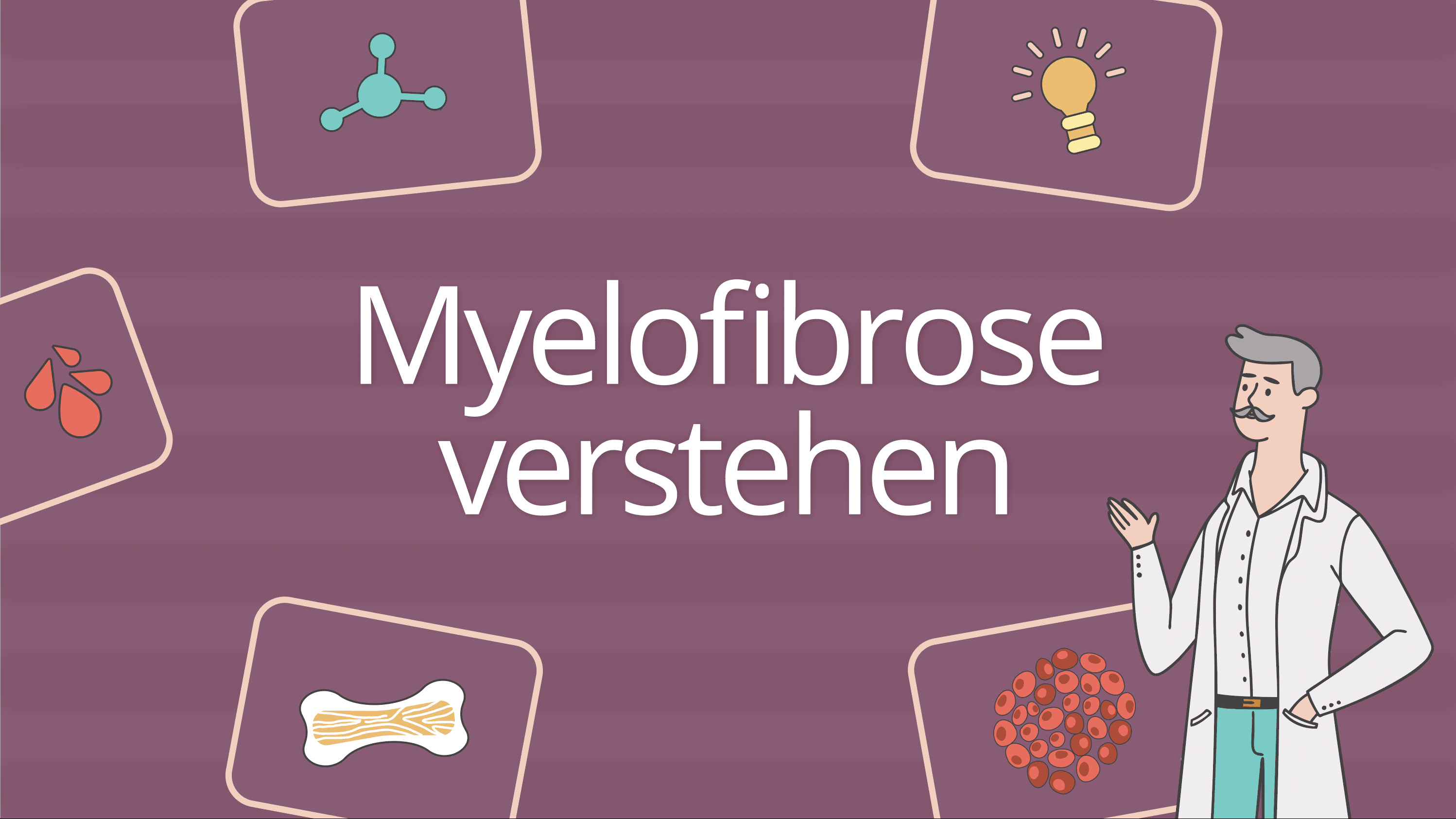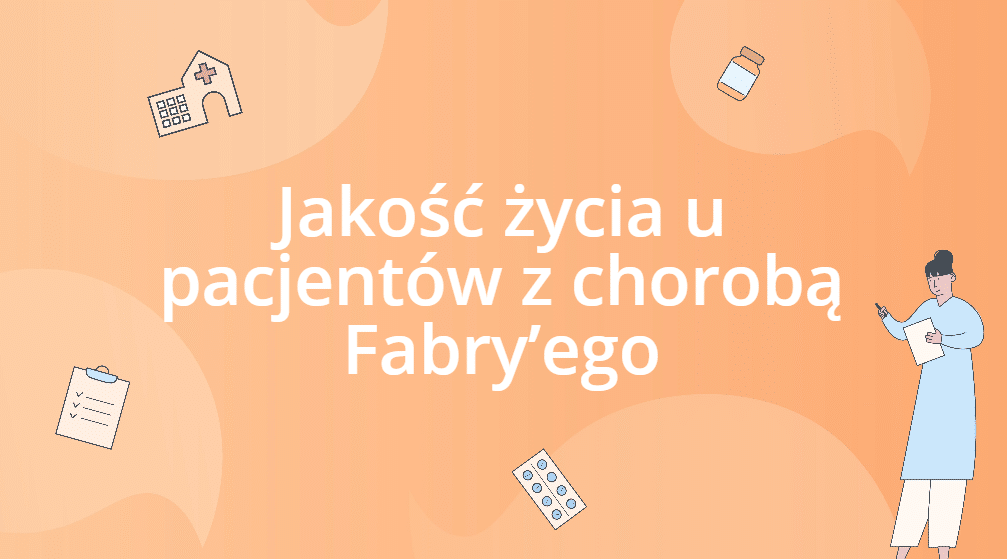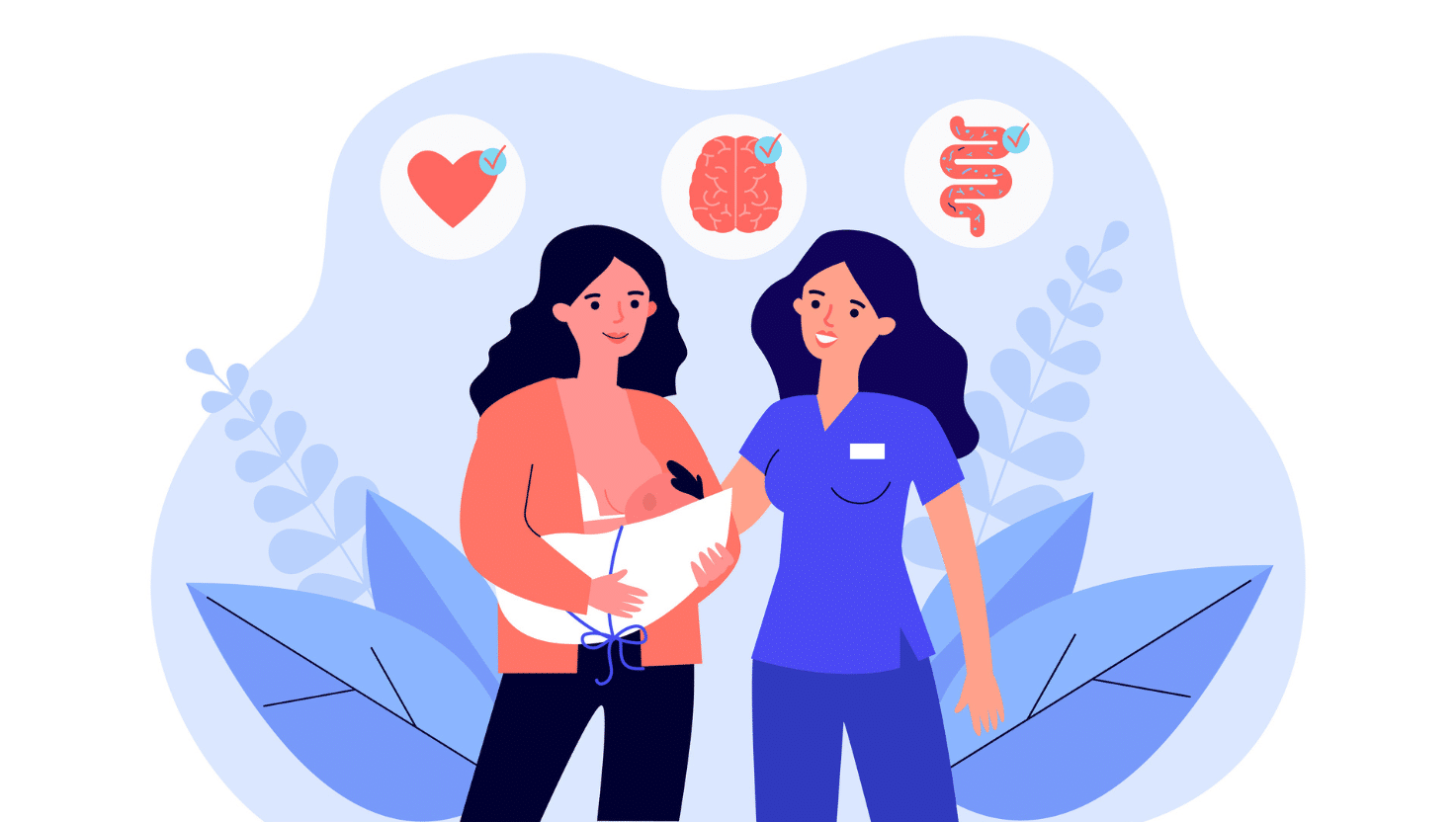Viele Angehörige und Freunde von KrebspatientenInnen haben Angst etwas falsch zu machen und und sind sich unsicher, wie sie die betroffene Person unterstützen können. Ziehen sich manchmal sogar infolgedessen komplett zurück. Alexander Böhmer erhielt im Alter von 20 Jahren die Diagnose „Osteoblastisches Osteosarkom High Grade“, das bedeutet Knochenkrebs. Im Zuge dessen verlor er im April 2019 sein rechtes Bein oberhalb des Knies. In seinem Gastbeitrag für selpers erklärt er, welches Verhalten er sich von seinen Angehörigen, insbesondere nach Beendigung der Therapie, gewünscht hat.
Meine Diagnose erhielt ich im Sommer 2018. Ich war geschockt. Krebs? Ich? Meine Angehörigen haben beinahe alle vorbildlich reagiert, jeder einzigartig, auf seine Art und Weise, aber doch waren alle gleich traurig, gleich erschrocken. Aber da war noch etwas, was ich in den Augen meiner Angehörigen gesehen habe. Dort war ein Ausdruck, den ich vorher nie in Ihren Augen gesehen habe, wenn sie mich angeschaut haben. Was ich sah, war Angst. Sie hatten Angst davor, dass es mir schlecht gehen wird. Angst davor, dass ich leide. Angst davor, dass ich vielleicht nicht mehr lange da bin. Und hier habe ich direkt einen Tipp für alle Patienten und für die Angehörigen. Redet über eure Angst. Es ist nichts verwerfliches, Ängste zu haben und darüber zu sprechen.
Auch als Angehöriger darf man Angst und Sorge haben, auch als Angehöriger, darf man darüber sprechen. Und ich rede nicht von der Angst vor dem Sterben. Viele haben Sorge, dass sie etwas Falsches sagen, machen oder fragen könnten, und ziehen sich deswegen zurück. Sprecht über diese Unsicherheit!
„Ich habe Sorge, etwas falsch zu machen, bitte sag mir, welches Verhalten du dir von mir wünschst.“
Oh, wie viel einfacher man sich die sowieso schon unangenehme Situation machen kann, wenn man offen miteinander redet.
Meine Angehörigen, waren für mich in dieser schweren Zeit die allergrößten Stütze. Sie waren immer an meiner Seite, haben mir aber immer das Gefühl von Normalität vermittelt. Kleine Ausflüge, wenn sie möglich waren, haben mir die wenigen Tage, die ich nicht im Krankenhaus sein musste, aufgehellt und mich gut abgelenkt. Aber gerade die kleinen Gesten waren es, die mir den Alltag schöner gemacht haben. Z.B hat meine Mutter uns immer einen Kaffee gekauft, wenn wir auf dem Weg zur Chemo waren. So hatte ich wenigstens den Kaffee, auf den ich mich am Vorabend freuen konnte.
Meine Therapie ist jetzt seit knapp 12 Monaten abgeschlossen, nach und nach komme ich zurück in mein altes Leben, das aber doch ganz anders ist. Ich lerne laufen, ich lerne es, meinem Körper wieder mehr zu vertrauen. Meine Angehörigen unterstützen mich weiterhin bei allem, bei dem ich Hilfe brauche, oder eher bei allem, bei dem ich Hilfe anfordere. Sie geben mir die Freiheit, die ich brauche, um wieder ins Leben zu finden, aber auch so viel Nähe, dass ich mich nicht überfordert oder allein fühle. Auch hier kann ich euch nur den Tipp geben, miteinander zu sprechen. Nur weil die Therapie beendet ist, ist man noch lange nicht „gesund“. Der Körper und auch die Seele brauchen lange, um nach Beendigung der Therapie normal zu funktionieren. Ich war viele Monate nach der Therapie immer noch oft sehr müde, unkonzentriert und schwach. Hier müssen die Angehörigen und Freunde verständnisvoll reagieren, denn selbst heute, 12 Monate nach der letzten Chemo, empfinde ich mich immer noch als unkonzentrierter und weniger belastbar als vor der Therapie.
Als Angehöriger, also Eltern, FreundIn, Schwester oder Bruder hat man sicher oft Angst davor, etwas nicht richtig zu machen. Aber nichts ist so falsch, wie sich aus Unsicherheit zurückzuziehen. Denn als Krebspatient braucht man neben Chemo und Medikamenten besonders eins: Liebe und Fürsorge.
Hier finden Sie unsere Angehörigenschulung „KrebspatientInnen unterstützen“
Hier finden Sie unseren Blogbeitrag zum Thema „Soziales Umfeld bei Krebs“