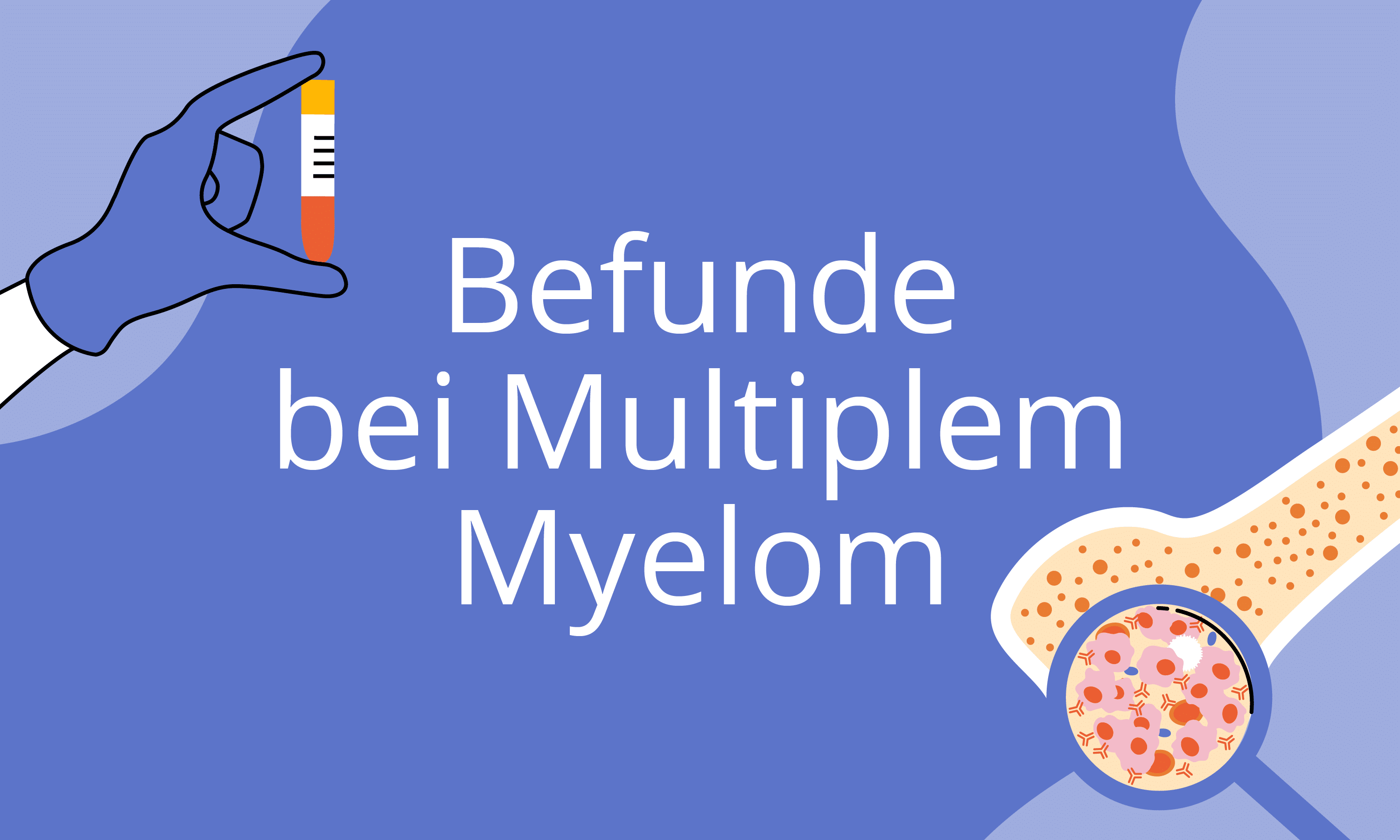Das ist ein Szenario, dass sich so oder so ähnlich in zahlreichen klinischen Studien ergeben kann. Denn es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Wirkstoffe, bevor sie zugelassen werden, in mehreren Phasen wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit getestet werden. Es ist üblich in der zweiten Phase dieses Testprozesses bei einer Testgruppe Scheinmedikamente, sogenannte Placebos, zu verabreichen. Diese Scheinmedikamente enthalten keinen Wirkstoff. Somit helfen Sie zu überprüfen, ob eine Behandlung mit dem getesteten Wirkstoff wirklich besser hilft als eine Behandlung ohne.
Trotzdem antwortet Frau Kainer auf die Frage, ob es ihr heute besser gehe als vor fünf Wochen, mit einem deutlichen Ja. Dieser Effekt wird auch der „Placebo-Effekt“ genannt. Bei zahlreichen Studien in unterschiedlichsten Bereichen kann dieser Effekt beobachtet werden. Wie kann das sein?
Wie der Placebo-Effekt wirkt
Um den Placebo-Effekt wissen ÄrztInnen schon lange Bescheid. Der Begriff „Placebo“ etablierte sich im medizinischen Bereich bereits im 18. Jahrhundert. Zuallererst hielt wohl der britischen Arzt Alexander Sutherland 1772 den Begriff schriftlich fest. Sutherland verwendete Scheinmedikamente, um die Erwartungen seiner PatientInnen zu erfüllen, und ihnen so auch ohne vorhandene Medikamente zu einer Linderung ihrer Schmerzen zu verhelfen.
Heute sind Placebos gerade durch ihre Verwendung in klinischen Studien viel besser erforscht. ForscherInnen konnten inzwischen zwei Wirkungswege von Placebos ermitteln. Der erste Faktor, durch den Placebos ihre Wirkung entfalten, sind erlernte Heilmechanismen des eigenen Körpers. Als langjährige Migränepatientin hat Frau Kainers Körper gelernt, dass bestimmte Tabletten eine Linderung der Schmerzen bewirken. Als Reaktion darauf aktiviert der Körper auch seine eigenen Heilmechanismen, und beginnt körpereigene schmerzlindernde Stoffe auszustoßen. Diese Reaktion kann auch eintreten, wenn die Tablette selbst keinen Wirkstoff enthält.
Der zweite Faktor ist die Erwartung eines heilenden Effekts:
Eine Studie der Universität Jena hat herausgefunden, dass das Schmerzempfinden von PatientInnen beim Stechen einer Nadel auch davon abhängt, mit welchen Worten die Ärztin/der Arzt den Nadelstich vorbereitet. Man nennt es Nocebo-Effekt, wenn gewisse Erwartungen der PatientInnen Erfahrungen verschlimmern oder sogar hervorrufen können.
Hätten die ÄrztInnen Frau Kainer zum Beispiel gewarnt, dass das Medikament auch Übelkeit hervorrufen kann, hätte ihr allein durch diese Erwartung tatsächlich übel werden können.
Die Erkenntnisse über Placebos nutzen lernen
Es ist möglich, die Lehren aus der Forschung mit Placebos bewusst für sich selbst zu nutzen. Denn worauf Placebos eigentlich hindeuten, ist die körpereigene Kraft von positiven Erwartungen und erlernten Denkmustern.
Besonders wichtig für die Wirkung dieser Prozesse ist dabei Ihre Erwartungshaltung. Eine Studie der Universität Essen konnte zeigen, dass ein Schmerzmittel doppelt so wirksam ist, wenn die Ärztin zuvor bestätigte, dass das zum Einsatz kommende Schmerzmittel stark ist. Dies zeigt, wie stark eine positive Einstellung die Wirksamkeit von Behandlungen unterstützen kann.
Auch das Erkennen von Schmerz als ein Umstand, der nicht nur negativ sein muss, kann helfen. LäuferInnen, die auf einen Marathon trainieren, können einen Muskelkater trotz der Schmerzen als positiv empfinden. Andererseits ist Schmerz oft besonders groß, wenn man Angst davor hat. Versuchen Sie, sich selbst zuzuhören. Können Sie negative Denkmuster erkennen? Falls ja, versuchen Sie, diese aufzuschreiben, und positive Gegenstücke zu finden.
Eine positive Erwartungshaltung bedeutet dabei nicht, die negativen Aspekte einfach zu ignorieren. Es heißt, die eigene Heilkraft des Körpers zu aktivieren.